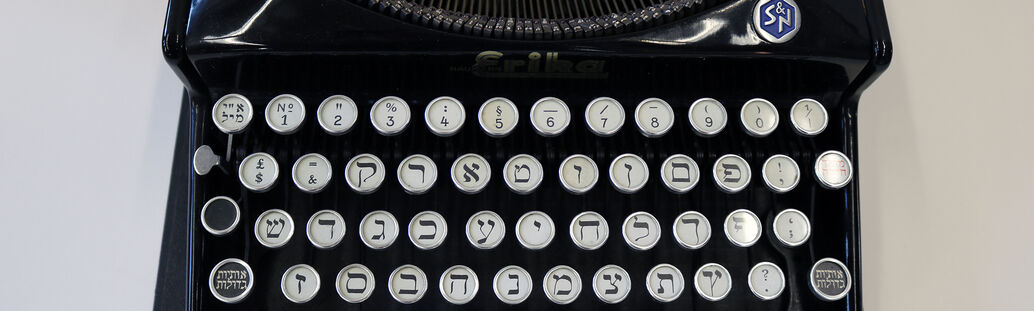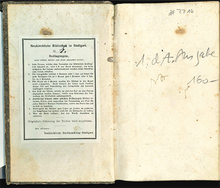Aufgeklärte Provenienzen
Das Stadtmuseum hat fünf Bücher einer „Neukirchlichen Bibliothek in Stuttgart“. Schlüsselperson war Johann Gottlieb Mittnacht, ein strenger und durchsetzungsfähiger Swedenborgianer, der 1875 die Deutsche Neukirchliche Gesellschaft (DNKG) gründete. Ihr Sitz war in Stuttgart. Dort wurde abseits des Privatbesitzes von Mittnacht eine Leihbücherei unterhalten.
Bei den Büchern handelt es sich also um den Besitz der DNKG, wobei wohl das ein oder andere Buch in den Handel kam, wovon die Tübinger Exemplare zeugen. Der Rest ist übergegangen an die liberalere, später umbenannte Deutsche Swedenborggesellschaft (DSG). Da die gesamten Stuttgarter Swedenborg-Aktivitäten zum Erliegen kamen, gibt es auch keinen Eigentumsanspruch auf ehemalige Exemplare dieser Neukirchlichen Bibliothek mehr.
Dass Tübingen mit Swedenborg eng verflochten ist, hängt mit dem tüchtigen und weit gebildeten Kollegen Johann Friedrich Immanuel Tafel (1796-1863) zusammen, der sich als gläubiger Swedenborgianer und Theologe weigerte, sich auf die Bekenntnisschriften der Evangelischen Kirche verpflichten zu lassen. Er wurde Bibliothekar an der Königlichen Universitätsbibliothek in Tübingen, später auch Professor für Philosophie. Er übersetzte Swedenborg aus dem Lateinischen und edierte zahlreiche Werke. Tübingen und Stuttgart waren also Zentren des süddeutschen Swedenborgianismus.