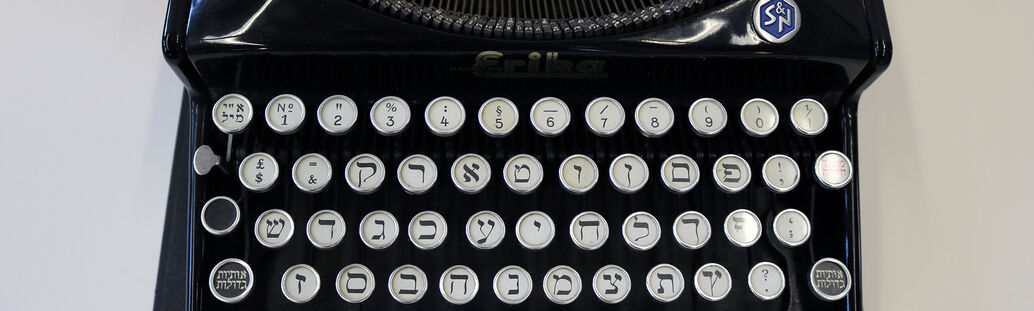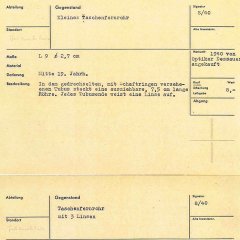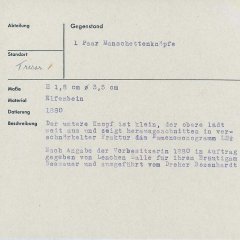Objekte aus dem Besitz von Adolf Dessauer
Adolf Dessauer, in den 1850er-Jahren in Wankheim geboren, betrieb gemeinsam mit seinem Bruder Jakob ein Optikgeschäft unter dem Namen „Gebrüder Dessauer“ in der Neckargasse 2 in Tübingen. Er lebte bis zu seinem Tod 1939 in der Uhlandstraße, wenn zuletzt auch als einziger seiner Familie und nur noch zur Miete: Anfang 1939 musste er sein Haus verkaufen, weil jüdischen Mitbürgern der Grundbesitz verweigert wurde. Dessauer hatte die Pogromnacht im November 1938 noch miterleben müssen. Von seinen drei Töchtern und zwei Söhnen, die alle in Tübingen geboren waren, hat nur eine Tochter den Holocaust überlebt.
Kölner Goldwaage
Schon bei Stichproben im Mai 2015 wurde die Provenienzforscherin Dr. Andrea Richter auf eine kleine Kölner Goldwaage aufmerksam. Sie war um 1750 aus Birnenbaumholz, Messing, Stahl und Kordeln gefertigt worden und gehörte einst Adolf Dessauer. Die Umstände des Verkaufs für gerade einmal zehn Reichsmark am 11. Januar 1939 sind nicht mehr in Gänze rekonstruierbar. Das als Familienerbstück einzustufende Objekt hätte zu diesem Zeitpunkt noch an Familienmitglieder in Tübingen oder Stuttgart übertragen werden können. Daher wird angenommen, dass die Waage unter Druck veräußert wurde. Die Stadt hat sich daher entschlossen, die Waage den Nachfahren Adolf Dessauers zurückzugeben.
Die heutigen Erben von Adolf Dessauer konnten mithilfe der Wiedergutmachungsakten der 1950er/1960er-Jahre und des Konsulats der Botschaft Israels in Berlin gefunden und informiert werden. Es handelt sich um drei Urenkel Dessauers. Sie stammen von verschiedenen Töchtern Dessauers ab. Die Erben haben darum gebeten, namentlich nicht genannt zu werden und wünschten keine Öffentlichkeit. Die Übergabe der Goldwaage fand am 7. November 2017 in kleinem Rahmen im Rathaus statt. Als Dank brachten die Erben ein Geschenk mit: einen achtarmigen Leuchter, Chanukkia genannt. Er steht als Symbol für das jüdische Lichterfest.
Weitere Informationen
städtische Pressemitteilung vom 13. November 2017
Zwei Fernrohre
Ebenfalls aus dem Besitz Adolf Dessauers stammen zwei Fernrohre. Sie wurden 1940 mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit bei der sogenannten „Freiwilligen Versteigerung“ des Nachlasses, die von Dessauers Tochter ausgerichtet wurde, erworben. Bisher sind die Fernrohre allerdings noch nicht in der Sammlung des Stadtmuseums gefunden worden. Sobald dies geschieht, sollen auch sie an die Erben zurückgegeben werden.
Manschettenknöpfe
Von Mathilde Sinner kamen 1948 ein Paar Manschettenknöpfe aus Elfenbein in die städtische Sammlung, die ebenfalls einen Bezug zu Adolf Dessauer besitzen. Mathilde Sinner war die Tochter des bekannten Tübinger Fotografen Paul Sinner und lange bei der Vorgängerinstitution des Stadtmuseums, dem Kunst- und Altertumsverein Tübingen, tätig. Neben den Manschettenknöpfen hat sie viel aus ihrem eigenen Familienbesitz der Sammlung überlassen.
Sie schien die Geschichte der Manschettenknöpfe gekannt zu haben, denn diese wurde auf einer alten Karteikarte notiert: Die Knöpfe aus Elfenbein wurden 1880 für den Hochzeitsanzug von Adolf Dessauer mit dem Namensmonogramm L H (Lenchen Halle) angefertigt. Lenchen Halle hatte sie für ihren Bräutigam Adolf Dessauer in Auftrag gegeben.
Mathilde Sinner hatte die Knöpfe vermutlich direkt von Adolf Dessauer oder aus seiner Familie erworben und dabei auch die Informationen zu den Objekten erhalten. Hier geht es um sehr persönliche Gegenstände, deren Übergabe an Nichtfamilienmitglieder sehr ungewöhnlich ist. Es wird daher angenommen, dass die Abgabe an Mathilde Sinner unter Druck geschah. Auch die Knöpfe konnten bisher noch nicht in der Sammlung gefunden werden. Bei Fund der Knöpfe müssen auch sie restituiert werden.